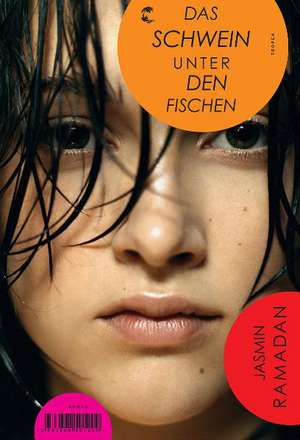Das Schwein unter den Fischen
Autor Jasmin Ramadande Limba Germană Paperback – 31 ian 2012
Preț: 113.77 lei
Nou
Puncte Express: 171
Preț estimativ în valută:
21.77€ • 22.78$ • 18.08£
21.77€ • 22.78$ • 18.08£
Carte indisponibilă temporar
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783608501209
ISBN-10: 3608501207
Pagini: 270
Dimensiuni: 142 x 210 x 30 mm
Greutate: 0.41 kg
Editura: Tropen
ISBN-10: 3608501207
Pagini: 270
Dimensiuni: 142 x 210 x 30 mm
Greutate: 0.41 kg
Editura: Tropen
Notă biografică
Jasmin Ramadan, geboren 1974, lebt in Hamburg. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Ägypter. Sie studierte Germanistik und Philosophie. 2009 gelang ihr mit ihrem Debüt »Soul Kitchen« zum gleichnamigen Kino-Hit von Fatih Akin ein Überraschungserfolg. Für ihren neuen Roman »Das Schwein unter den Fischen« erhielt sie den Hamburger Förderpreis für Literatur. Mehr über die Autorin unter: www.jasminramadan.de