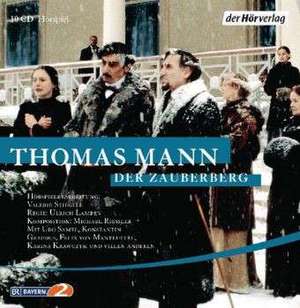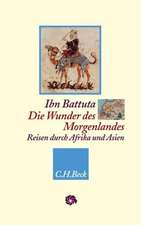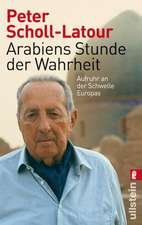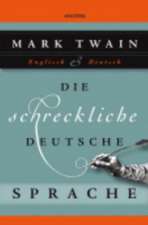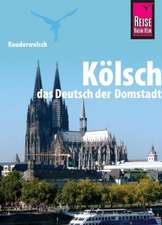Der Zauberberg
Autor Thomas Mann Udo Samel, Konstantin Graudus, Felix von Manteuffel, Karina Krawczykde Limba Germană CD-Audio – 11 sep 2007
DerBand5der'GroßenkommentiertenFrankfurterAusgabe'folgtdemErstdruck.
| Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
|---|---|---|
| Paperback (2) | 145.30 lei 17-23 zile | +13.03 lei 4-10 zile |
| FISCHER Taschenbuch – apr 1991 | 145.30 lei 17-23 zile | +13.03 lei 4-10 zile |
| FISCHER Taschenbuch – 5 apr 2012 | 161.22 lei 17-23 zile | +14.44 lei 4-10 zile |
| Hardback (1) | 195.41 lei 17-23 zile | +17.52 lei 4-10 zile |
| FISCHER, S. – 20 aug 2003 | 195.41 lei 17-23 zile | +17.52 lei 4-10 zile |
Preț: 170.24 lei
Nou
Puncte Express: 255
Preț estimativ în valută:
28.75€ • 29.90$ • 23.73£
28.75€ • 29.90$ • 23.73£
Indisponibil temporar
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783867171199
ISBN-10: 386717119X
Dimensiuni: 134 x 136 x 30 mm
Greutate: 0.27 kg
Editura: Hoerverlag DHV Der
ISBN-10: 386717119X
Dimensiuni: 134 x 136 x 30 mm
Greutate: 0.27 kg
Editura: Hoerverlag DHV Der
Notă biografică
Descriere
Descriere de la o altă ediție sau format:
Der Zauberberg ist einerseits ein Zeitroman, der die geistige Lage der europäischen Vorkriegszeit vor dem Ersten Weltkrieg in Form vor allem von Diskussionen zwischen den Protagonisten des Romans und Reflexionen des Erzählers seziert; er besitzt zugleich Elemente eines klassischen Bildungsromans, der seinen jungen Helden Hans Castorp in Auseinandersetzung mit geistigen Gehalten einen eigenen tragfähigen humanistischen Standpunkt suchen lässt, und er behandelt gewissermaßen philosophisch das Wesen der Zeit, das im Roman in der im Gegensatz zur bürgerlicher Arbeitswelt und ihren Zeiteinteilungen stehenden unwirklichen und zeitlosen Atmosphäre der Bergwelt des Davoser Sanatoriums verhandelt wird. Entstehung: Die ursprünglich als Satyrspiel und parodistisches Gegenstück zum Tod in Venedig konzipierte Erzählung, die biografisch auf einen Aufenthalt Thomas Manns in Davos 1912 zurückgeht, wurde im Laufe der langen Entstehungszeit von rund zehn Jahren zwischen 1913 und 1924 zum umfassenden philosophischen Roman erweitert und erfuhr im Verlauf durch äußere Ereignisse wie dem Ersten Weltkrieg und begleitende Arbeiten des Autors wie dem Essay Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) mehrfach Veränderungen. Inhalt: Der 24-jährige Hamburger Patriziersohn Hans Castorp reist vor Antritt seiner Ingenieursausbildung zu Besuch seines lungenkranken Vetters in das Sanatorium Bergfried im schweizerischen Davos. Aus den geplanten drei Wochen Aufenthalt werden sieben Jahre. In der gewissermaßen zeitentrückten, atmosphärisch von Krankheit und Tod geprägten Berg- bzw. Sanatoriumswelt erweist sich der >>einfache junge Mensch<< als leicht empfänglich für die sinnlichen und geistigen Einflüsse und die von den einzelnen Romanpersonen vertretenen weltanschaulichen Positionen. Hierbei stehen die verführerische Russin Clawdia Chauchat, der >>Zivilisationsliterat<< Settembrini, der fanatische Jesuitenschüler Naphta sowie die später auftretende >>große Persönlichkeit<< des Mynheer Peeperkorn sich in wechselnden Konstellationen als aufeinander bezogene Antipoden gegenüber, die gewissermaßen um die Seele des Helden kämpfen. Während der Vetter Joachim nach seiner verfrühten Abreise zurückkehrt und an seiner Krankheit stirbt (>>Als Soldat und brav<<), findet Hans Castorps Aufenthalt und damit der Roman sein abruptes Ende in dem ausbrechenden Weltkrieg, in dem sich die Spur des Helden verliert. Aufbau: Der Roman ist in sieben Kapitel aufgeteilt, in Analogie zu den sieben Jahren, die Hans Castorp im Sanatorium verbringt, doch bleiben nur die ersten drei Kapitel zeitlich eng auf die ersten Tage und Wochen des Aufenthalts beschränkt, während die restlichen Kapitel in lockerem zeitlichem, episodenhaft erzähltem Verhältnis zur Handlungszeit stehen. Das Kapitel Walpurgisnacht, in dem die Liebesbegegnung zwischen Hans und Clawdia Chauchat stattfindet, steht etwa in der Mitte des Romans. Ihm folgt im Gegensatz zum rauschhaften Verführungsgeschehen eine als Aufwärtsentwicklung angedeutete geistig-menschliche Entwicklung Hans Castorps, die im folgenden Kapitel Schnee in einem zentralen Traumerlebnis Castorps ihren Orientierungspunkt besitzt. Dort findet sich, als Quintessenz der aus den Reflexionen und Unterhaltungen gewonnenen Erkenntnis, der einzige im Werk von Mann gesperrt gesetzte Satz: >>Der Mensch soll um der Liebe und Güte willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken.<< Freilich ist diese humanistisch-positive Einsicht des Helden als ein Traum qualifiziert, der keine Konsequenzen nach sich zieht. Der Roman als Ganzes unterstreicht vielmehr die grundsätzliche Relativität sämtlicher geistiger Inhalte und Standpunkte gegenüber einer Faktizität des Willens zur Macht, die zeitgeschichtlich im Krieg zum Ausdruck kommt. Wirkung: Der Zauberberg gehört zu den am intensivsten rezipierten Romanwerken von Mann. Nach dem Erscheinen mischte sich große Bewunderung mit Kritik vor allem an der Intellektualität des Romans, der Philosophie, Theologie, Medizin, Psychoanalyse und anderes mehr ausgiebig verhandelt. Insgesamt wird der Roman als groß angelegtes geistiges Panorama der Vorkriegszeit und damit des Endes einer bürgerlichen Kultur verstanden. Für Mann bedeutet das Werk selbst vor allem eine klärende Auseinandersetzung über seinen ästhetischen Standpunkt im Verhältnis zur Politik und zum Ersten Weltkrieg. Ein großer Teil der Reflexionen und Überlegungen des Romans ist - bei nun veränderter Grundeinstellung - dem kurz zuvor verfassten politischen Essay Betrachtungen eines Unpolitischen entnommen. Der Zauberberg hat auch in späteren Jahren immer wieder das Interesse auf sich gezogen und wurde 1981 von Hans Werner Geissendörfer verfilmt. .
Der Zauberberg ist einerseits ein Zeitroman, der die geistige Lage der europäischen Vorkriegszeit vor dem Ersten Weltkrieg in Form vor allem von Diskussionen zwischen den Protagonisten des Romans und Reflexionen des Erzählers seziert; er besitzt zugleich Elemente eines klassischen Bildungsromans, der seinen jungen Helden Hans Castorp in Auseinandersetzung mit geistigen Gehalten einen eigenen tragfähigen humanistischen Standpunkt suchen lässt, und er behandelt gewissermaßen philosophisch das Wesen der Zeit, das im Roman in der im Gegensatz zur bürgerlicher Arbeitswelt und ihren Zeiteinteilungen stehenden unwirklichen und zeitlosen Atmosphäre der Bergwelt des Davoser Sanatoriums verhandelt wird. Entstehung: Die ursprünglich als Satyrspiel und parodistisches Gegenstück zum Tod in Venedig konzipierte Erzählung, die biografisch auf einen Aufenthalt Thomas Manns in Davos 1912 zurückgeht, wurde im Laufe der langen Entstehungszeit von rund zehn Jahren zwischen 1913 und 1924 zum umfassenden philosophischen Roman erweitert und erfuhr im Verlauf durch äußere Ereignisse wie dem Ersten Weltkrieg und begleitende Arbeiten des Autors wie dem Essay Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) mehrfach Veränderungen. Inhalt: Der 24-jährige Hamburger Patriziersohn Hans Castorp reist vor Antritt seiner Ingenieursausbildung zu Besuch seines lungenkranken Vetters in das Sanatorium Bergfried im schweizerischen Davos. Aus den geplanten drei Wochen Aufenthalt werden sieben Jahre. In der gewissermaßen zeitentrückten, atmosphärisch von Krankheit und Tod geprägten Berg- bzw. Sanatoriumswelt erweist sich der >>einfache junge Mensch<< als leicht empfänglich für die sinnlichen und geistigen Einflüsse und die von den einzelnen Romanpersonen vertretenen weltanschaulichen Positionen. Hierbei stehen die verführerische Russin Clawdia Chauchat, der >>Zivilisationsliterat<< Settembrini, der fanatische Jesuitenschüler Naphta sowie die später auftretende >>große Persönlichkeit<< des Mynheer Peeperkorn sich in wechselnden Konstellationen als aufeinander bezogene Antipoden gegenüber, die gewissermaßen um die Seele des Helden kämpfen. Während der Vetter Joachim nach seiner verfrühten Abreise zurückkehrt und an seiner Krankheit stirbt (>>Als Soldat und brav<<), findet Hans Castorps Aufenthalt und damit der Roman sein abruptes Ende in dem ausbrechenden Weltkrieg, in dem sich die Spur des Helden verliert. Aufbau: Der Roman ist in sieben Kapitel aufgeteilt, in Analogie zu den sieben Jahren, die Hans Castorp im Sanatorium verbringt, doch bleiben nur die ersten drei Kapitel zeitlich eng auf die ersten Tage und Wochen des Aufenthalts beschränkt, während die restlichen Kapitel in lockerem zeitlichem, episodenhaft erzähltem Verhältnis zur Handlungszeit stehen. Das Kapitel Walpurgisnacht, in dem die Liebesbegegnung zwischen Hans und Clawdia Chauchat stattfindet, steht etwa in der Mitte des Romans. Ihm folgt im Gegensatz zum rauschhaften Verführungsgeschehen eine als Aufwärtsentwicklung angedeutete geistig-menschliche Entwicklung Hans Castorps, die im folgenden Kapitel Schnee in einem zentralen Traumerlebnis Castorps ihren Orientierungspunkt besitzt. Dort findet sich, als Quintessenz der aus den Reflexionen und Unterhaltungen gewonnenen Erkenntnis, der einzige im Werk von Mann gesperrt gesetzte Satz: >>Der Mensch soll um der Liebe und Güte willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken.<< Freilich ist diese humanistisch-positive Einsicht des Helden als ein Traum qualifiziert, der keine Konsequenzen nach sich zieht. Der Roman als Ganzes unterstreicht vielmehr die grundsätzliche Relativität sämtlicher geistiger Inhalte und Standpunkte gegenüber einer Faktizität des Willens zur Macht, die zeitgeschichtlich im Krieg zum Ausdruck kommt. Wirkung: Der Zauberberg gehört zu den am intensivsten rezipierten Romanwerken von Mann. Nach dem Erscheinen mischte sich große Bewunderung mit Kritik vor allem an der Intellektualität des Romans, der Philosophie, Theologie, Medizin, Psychoanalyse und anderes mehr ausgiebig verhandelt. Insgesamt wird der Roman als groß angelegtes geistiges Panorama der Vorkriegszeit und damit des Endes einer bürgerlichen Kultur verstanden. Für Mann bedeutet das Werk selbst vor allem eine klärende Auseinandersetzung über seinen ästhetischen Standpunkt im Verhältnis zur Politik und zum Ersten Weltkrieg. Ein großer Teil der Reflexionen und Überlegungen des Romans ist - bei nun veränderter Grundeinstellung - dem kurz zuvor verfassten politischen Essay Betrachtungen eines Unpolitischen entnommen. Der Zauberberg hat auch in späteren Jahren immer wieder das Interesse auf sich gezogen und wurde 1981 von Hans Werner Geissendörfer verfilmt. .