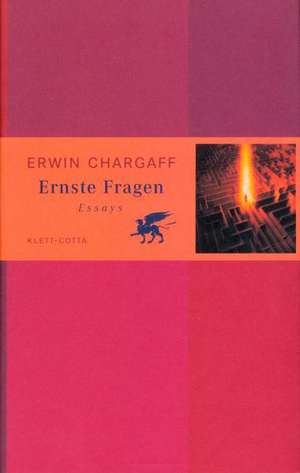Ernste Fragen
Traducere de Joachim Kalka Autor Erwin Chargaffde Limba Germană Hardback – 31 iul 2000
Preț: 124.27 lei
Nou
Puncte Express: 186
Preț estimativ în valută:
23.78€ • 24.73$ • 19.90£
23.78€ • 24.73$ • 19.90£
Carte indisponibilă temporar
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783608934205
ISBN-10: 3608934200
Pagini: 288
Dimensiuni: 134 x 216 x 32 mm
Greutate: 0.42 kg
Editura: Klett-Cotta Verlag
ISBN-10: 3608934200
Pagini: 288
Dimensiuni: 134 x 216 x 32 mm
Greutate: 0.42 kg
Editura: Klett-Cotta Verlag
Recenzii
»Hoffnung
an
den
geraden
Tagen
Essays:
Erwin
Chargaff
stellt
ernste
Fragen
und
will
langsam
gelesen
werden
Für
einen
großen
Grantler
könnte
man
ihn
halten,
besäße
er
nicht
diesen
ausgeprägten
Sinn
für
Humor
und
Ironie,
diesen
Spaß
an
Witz
und
Sprache.
Unverdrossen
schleudert
Erwin
Chargaff
seine
Sprachblitze
gegen
die
heutige
Welt
und
ihre
Sterblichen,
denen
er,
soeben
fünfundneunzig
Jahre
alt
geworden,
in
seiner
Wohnung
im
dreizehnten
Stock
am
Central
Park
in
New
York
fast
entrückt
erscheint.
Doch
macht
ihn
weniger
das
Alter
zu
einem
Solitär
als
vielmehr
die
kompromisslose
Kritik
sowie
eine
heute
-
zumal
unter
Naturwissenschaftlern
-
nur
noch
selten
anzutreffende
Bildung.
Der
in
Czernowitz
geborene
Chargaff,
einer
der
Wegbereiter
zur
Aufdeckung
der
DNS-Doppelhelixstruktur,
erscheint
nicht
nur
geographisch
emigriert:
«Ich
bin
wahrscheinlich
der
einzige
Biochemiker,
der
William
Blake
liest»,
behauptete
er
in
gewohnter
Zuspitzung
erst
kürzlich
in
einem
Interview.
Die
neue
Essay-Sammlung
ist
die
überarbeitete
Übersetzung
eines
Bandes,
der
schon
in
den
achtziger
Jahren
im
englischen
Original
herauskam.
Sie
besteht
aus
kleinen
Versuchen
über
Begriffe,
die
Chargaff
sich
gelegentlich
in
einem
Notizbuch
zur
späteren
Bearbeitung
vermerkt
hatte.
Als
die
«Serious
Questions»
damals
übersetzt
werden
sollten,
schrieb
Chargaff
statt
dessen
eine
neue
Folge,
die
als
«Alphabetische
Anschläge»
veröffentlicht
wurde.
Jetzt
wird
auch
der
erste
Teil
auf
Deutsch
zugänglich
und
sein
Alphabet
um
31
Einträge
erweitert.
Ernste
Themen
sind
fürwahr
darunter:
von
Holocaust,
Krieg
und
Tod
handeln
drei
der
Texte.
Doch
auch
bei
«Zauberflöte»
findet
sich
kein
altersschwaches
Schwelgen
in
k.u.k.-Opernerinnerungen,
sondern
eine
bissige
Polemik
gegen
Forschungen
der
CIA
auf
dem
Gebiet
der
Gehirnwäsche.
Nein,
heiteres,
unbeschwertes
Plaudern
ist
Chargaffs
Sache
wirklich
nicht.
«Die
größte
Traurigkeit,
die
schon
an
die
große
Niedergeschlagenheit
grenzt,
ist
die
Traurigkeit
des
Alterns.»
Dass
die
«Tristitia»,
der
er
diese
Reflexion
widmet,
zu
den
Todsünden
zählt,
mag
Chargaff
nicht
begreifen.
«Der
Herbst
der
Seele
muss
nicht
ihr
Niedergang
sein.»
Die
Trauer
über
Verlorenes
ist
Chargaff
stets
auch
Antriebskraft
gewesen,
da
sie
mit
der
Hoffnung
Hand
in
Hand
geht.
Zwar
bezeichnet
er
sich
als
notorischen
Pessimisten,
als
«Hausierer
der
Trübsal».
Doch
am
Ende
gibt
sich
Erwin
Chargaff
vor
allem
als
ein
großer
Skeptiker,
der
eine
unbestimmte
Hoffnung
nicht
fahren
lassen
will,
weder
für
das
eigene
Nachleben
noch
für
die
Rettung
der
hiesigen
Welt.
Begriffe
im
Säurebad
«Welche
Form
die
Rettung
annehmen
könnte
-
wer
kann
das
sagen?
Aber
ich
glaube,
zumindest
an
den
geraden
Tagen
des
Monats,
dass
sie
kommen
wird.»
Und
sogar
von
wem
sie
zu
erwarten
ist,
glaubt
Chargaff
zu
wissen:
von
den
Amateuren,
den
Unklassifizierbaren,
die
«der
lächerlichen
Ehrfurcht
vor
dem
Spezialistentum»
entsagen
-
notorisch
Einzelne,
Montaigne-Typen,
die
vor
allem
eine
Fähigkeit
besitzen:
«die
Unfähigkeit,
Scheuklappen
zu
tragen».
Am
Ende
kreisen
die
Gedanken
des
großen
Scheuklappenverächters
immer
um
die
gleichen
Grundmotive:
den
Kulturverfall
und
das
hypertrophe
Spezialistentum
einschließlich
der
Überschätzung
der
Naturwissenschaften.
Umso
mehr
erstaunt
es,
wie
wenig
redundant
die
Stücke
sind.
Ob
die
Stichwörter
nun
«Dekadenz»,
«Massenmedien»
oder
«Schwindel,
in
den
Wissenschaften
und
anderswo»
lauten:
Stets
zeigt
Chargaff
sich
als
fintenreicher
Essayist,
findet
einen
neuen
Ansatzpunkt
und
unerwartete
Wendungen.
Er
zerlegt
die
Begriffe
wie
ein
Chemiker
in
immer
neuen
Versuchsanordnungen
(vorzugsweise
im
Säurebad
der
Etymologie),
um
sie
dann
heftig
reagieren
zu
lassen.
Dabei
ist
dem
Verehrer
der
Alchemie
der
Weg
nicht
minder
wichtig
als
das
Ziel,
das
wird
in
der
Leseanweisung
deutlich:
«Es
war
ein
langsam
gewachsenes
Buch
und
sollte
langsam
gelesen
werden.»
Chargaffs
Texte
sind
keine
radioaktiven
Elemente:
Sie
kennen
vorerst
keine
Halbwertszeit,
und
leider,
so
ist
zu
befürchten,
kontaminieren
sie
ihre
Umwelt
nicht
so
schnell
wie
die
binnen
Wochenfrist
verfallenden
Produkte
der
Chargaff
verhassten
Werbetexter
und
PR-Agenturen,
die
dem
«kategorischen
Superlativ»
gehorchen.
Gleichwohl
atmen
die
Texte
eine
Frische,
die
sich
der
Klarheit
des
Autors
verdankt
und
in
der
Übertragung
von
Joachim
Kalka
nichts
verloren
hat.
Auch
wenn
man
einigen
Stellen
(bei
Seitenhieben
auf
den
«derzeit
regierenden
Opa»,
gemeint
ist
Ronald
Reagan)
den
Entstehungskontext
der
achtziger
Jahre
anmerkt,
wirken
die
Versuche
niemals
überholt,
im
Gegenteil.
Chargaff
kann
es
getrost
mit
Karl
Kraus,
seinem
Lehrer
in
Sachen
Sprache
und
Kritik,
halten.
Man
müsse
wohl
warten,
bis
seine
Texte
veraltet
seien:
«Dann
werden
sie
möglicherweise
Aktualität
erlangen.«Achim
Bahnen
(Literaturen,
01.11.2000)»Der
Prophet
aus
New
York,
der
übergangen
wurde
Erwin
Chargaff
bleibt
sich
und
seinen
Warnungen
treu
-
ebenso
wie
der
Biotechnologie
Es
kommt
nicht
alle
Tage
vor,
dass
ein
amerikanischer
Präsident
sich
der
Weltfernsehöffentlichkeit
im
Oval
Office
als
Gastgeber
von
Wissenschaftlern
präsentiert.
In
diesem
Sommer
fand
ein
solches
Treffen
statt,
als
Bill
Clinton
die
Fntschlüsselung
der
menschlichen
Erbanlagen
bekannt
gab.
Man
darf
vermuten,
dass
von
den
vielen
Worten,
die
auf
dieser
mit
viel
Pathos
inszenierten
Veranstaltung
gesprochen
wurden,
ein
Satz
einen
alten
Mann
in
New
York
besonders
schmerzte:
«Thank
you,
Dr.
Watson»,
sagte
Clinton
zu
dem
Mann,
der
zusammen
mit
seinem
Partner
Francis
Crick
in
den
50er-Jahren
entdeckte,
dass
die
Gene
in
der
Form
einer
doppelten
Spirale
aufgereiht
sind,
Diese
Entdeckung,
für
die
die
beiden
später
den
Nobelpreis
erhielten,
geht
wesentlich
auf
Überlegungen
zurück,
die
Erwin
Chargaff
den
damals
noch
unbekannten
Studenten
dargelegt
hatte.
Gleichwohl
ging
er
damals
wie
auch
später
leer
aus:
Watson
und
Crick
kennt
jedes
Schulkind,
von
Chargaff
ist
dagegen
nur
noch
die
Rede
im
Zusammenhang
mit
den
Gefahren,
die
von
der
Bio-
und
Gentechnologie
ausgehen.
Diese
Kränkung
hat
Chargaff,
der
im
August
95
Jahre
alt
geworden
ist,
nie
verwunden,
und
seine
ehemaligen
Kollegen
halten
sie
ihm
immer
wieder
vor,
indem
sie
seine
Kritik
an
der
modernen
Naturwissenschaft
als
Reflex
eines
Zukurzgekommenen
abtun.
In
seinem
neuesten
Buch
stellt
Chargaff,
wie
es
bereits
im
Titel
heisst,
«ernste
Fragen»
-
in
denen
der
in
Wien
geborene
und
später
von
Berlin
über
Paris
nach
New
York
emigrierte
Wissenschaftler
nicht
mit
der
an
seinem
Lieblingsautor
Karl
Kraus
geschulten
Polemik
geizt
und
häufig
ins
Schwarze
trifft.
So
lohnt
es
sich
beispielsweise,
mit
Chargaff
einmal
der
Frage
nachzugehen,
woher
das
Wort
«Forschung»
in
unseren
modernen
Gesellschaften
seinen
Zauberglanz
bezieht,
der
nicht
nur
Millionen
aus
öffentlichen
Geldsäckeln
lockerzumachen
vermag,
sondern
auch
als
Generalerklärung
dient:
Wenn
also
jemand
fragt:
«Was
macht
denn
Ihr
Sohn
jetzt?»,
so
ruft
es
nicht
nur,
wie
Chargaff
in
einem
seiner
anekdotengespickten
Essays
berichtet,
Respekt,
sondern
auch
Zufriedenheit
hervor,
wenn
die
Antwort
lautet:
«Der
ist
in
der
Forschung.»
Die
Zusatzfrage
nach
der
Art
der
Forschung
sei,
wie
der
Karl
Kraus
von
New
York
erklärt,
ebenso
unerhört
wie
im
Falle
der
Antwort
«Mein
Sohn
ist
Leichenbestatter»
die
Frage
«Ach,
welche
Leichen
bestattet
er
denn?»
Die
Unterschiede
zwischen
den
beiden
Fragen
verflachen,
wenn
die
Besonderheiten
in
der
Forschung
nivelliert
werden
und
die
wissenschaftliche
Arbeit
zum
Job
verkommt.
Reichlich
altmodisch,
deshalb
aber
nicht
falsch
klingt
da
Chargaffs
begeisterte
Erinnerung
an
die
Zeit
der
«grossen
Wissenschaftsamateure»
im
viktorianischen
England.
Nicht
Preise
oder
sonstiger
Lorbeer
trieben
diese
Forscher
an,
sondern
der
Wunsch
nach
Erkenntnis
der
Natur.
Den
heutigen
Nachwuchswissenschaftlern
werde
dieser
edle
Drang
dagegen
durch
die
Konkurrenz
im
Grossforschungslabor
und
das
Diktat
festgelegter
Forschungsziele
vergällt.
Unter
diesem
Fluch
der
Professionalisierung
der
Forschung
gehe,
wie
Chargaff
beklagt,
auf
der
Seite
der
Wissenschaft
die
Fantasie
und
Kreativität
verloren
und
auf
der
Seite
der
Moral
die
Verantwortung.
Die
Amateure,
die
in
unserer
Zeit
der
Wissenschaft
so
gescholten
und
verachtet
werden,
haben
gegenüber
den
Profiforschern,
die
natürlich
in
jedem
anderen
Gebiet
ausserhalb
ihres
eigenen
auch
wiederum
Amateure
sind,
die
grosse
Stärke,
Fragen
stellen
zu
dürfen
-
beispielsweise
die
Frage,
warum
müssen
wir
das
alles
wissen?
Diese
einfache
und
recht
naive
Frage
rührt
indes
ans
System.
Das
weiss
der
erfahrene
Naturwissenschaftler
Chargaff
und
plädiert
gerade
deshalb
ungerührt
für
eine
Kürzung
der
Naturwissenschaftsetats.
Das
wäre
dann
der
Anfang
der
Revolte
gegen
die
Spezialisten,
und
die
wird,
wie
Chargaff
prophezeit,
kommen,
denn
«mehr
und
mehr
Menschen
begreifen,
dass
es
viel
schlimmer
als
reine
Unwissenheit
ist,
wenn
man
zur
falschen
Zeit
die
falschen
Dinge
weiss».
Dass
er
auch
mit
seinem
neuen
Buch
wahrscheinlich
nur
die
erreichen
wird,
die
gleich
ihm
den
aktuellen
Wissenschaftsbetrieb
mit
gehöriger
Skepsis
betrachten,
ist
Chargaff
wohl
bewusst.
Das
Rufen
gibt
der
Prophet
in
der
Wüste
deshalb
aber
auch
in
seiner
zehnten
Lebensdekade
nicht
auf,
und
da
muss
man
sich
wohl
bald
fragen,
ist
er
wirklich
nur
ein
Nörgler
oder
nicht
doch
ein
Optimist?«Andreas
Brenner
(Tages-Anzeiger,
16.10.2000)»Ernste
Fragen
Kulturkritik
mit
Erwin
Chargaff
Eine
langsame
Bewegung
abwärts
bestimmt
dieses
Buch,
ein
Sisyphos-Effekt
gewissermaßen,
den
man
als
Leser
mit
Sympathie
wahrnimmt.
Oder,
mit
den
Worten
Nietzsches,
des
omipräsenten
Stichwortgebers
dieser
Tage:
?Seit
Copernikus
rollt
der
Mensch
aus
dem
Centrum
ins
x.
?
Kulturpessimismus
-
würden
die
klugen
Leute
sagen,
die
erst
mal
ein
Genre
brauchen,
damit
sie
bei
der
Lektüre
nicht
die
Linie
verlieren.
Der
Autor
liefert
durchaus
Aspekte
für
eine
solche
Klassifizierung:
?Das
Buch
Hiob
bleibt
für
mich
eines
der
größten
Gedichte,
die
je
geschrieben
wurden.
?
Es
lief
auch
in
der
Tat
alles
ein
wenig
merkwürdig
mit
diesem
Buch
von
Erwin
Chargaff.
1986
ist
es
in
Amerika
erschienen,
als
?ABC
of
Sceptical
Reflections?,
nun
erst
hat
es
der
Verlag
Klett-Cotta
als
eine
Art
Geburtstagsgabe
auf
Deutsch
herausgebracht
-
gestern
ist
Erwin
Chargaff
95
geworden.
Der
amerikanische
Verlag
hatte
damals
Pleite
gemacht:
?So
wurden
wenige
Exemplare
verkauft,
keine
einzige
Anzeige
ist
mir
zu
Gesicht
gekommen
und
keine
einzige
Rezension.
Vom
technischen
Gesichtspunkt
betrachtet
war
es
hingegen
ein
schön
gemachtes
Buch.
?
Ein
Chemieprofessor,
ein
Genforscher,
der
sich
Gedanken
macht
über
den
Zustand
der
Kultur
-
darüber,
dass
unsere
Kultur
ziemlich
heruntergekommen
ist.
Das
beginnt
immer
auf
die
gleiche
Weise,
mit
dem
Grübeln
über
Wörter,
mit
physischen
Reaktionen
auf
Sätze
und
Sprüche.
Der
amerikanische
Präsident
zum
Beispiel
spricht
von
Demokratie
-
derjenige,
der
einst
Landungstruppen
auf
eine
winzige
Karibikinsel
sandte,
wohlgemerkt
-
und
Chargaff
beginnt
sich
nach
einer
solchen
Demokratie
zu
sehnen
wie
nach
einer
Wundermedizin
gegen
die
Schwächen
des
Alters.
?So
schlug
ich
in
Keywords,
dem
ausgezeichneten
Buch
von
Raymond
Williams,
nach,
das
den
verschlungenen
Wegen
der
Bedeutung
wichtiger
englischer
Wörter
durch
die
Jahrhunderte
folgt.
Das
Wort
,Demokratie?
stellte
sich
als
besonders
schlüpfrig
und
schlangengleich
heraus.
Wenn
ich
glaubte,
ich
hätte
es
erfaßt,
entzog
es
sich
mir
mit
der
Agilität
eines
Aals
und
verschwand
im
trüben
Tümpel
des
schamlosen
Werbejargons.
?
Die
Skala
der
Schlüsselwörter,
die
Chargaff
abhandelt,
geht
von
Amateur
bis
Zauberflöte,
über
Forschung
und
Geschlechtsleben
(der
Grammatik!),
Holocaust
und
Labyrinth,
Mausoleum
-
?der
Name,
den
ich
meinem
neu
angeschafften
Computer
gab,
als
ich
in
einem
lebhaften
Kampf
mit
ihm
begriffen
war?
-
und
Quintessenz
-
?wahrhaftig
ein
Wort
zum
verlieben?.
Die
Tonlage
reicht
vom
melancholischen
Kalauer
-
in
der
Tradition
von
Karl
Kraus
-
bis
zu
mildem
Sarkasmus
und
zu
heftigem
Zynismus,
mit
dem
Chargaff
auf
die
Exzesse
der
Zivilisation
reagiert:
?Eine
Portion
Gefrorenes?
überschreibt
er
seine
Betrachtungen
zur
künstlichen
Befruchtung,
ausgehend
von
einer
Meldung
in
der
New
York
Times
vom
11.
April
1984:
?Erstes
Kind
aus
tiefgefrorenem
Embryo
geboren?.
Viel
gibt
es,
was
einen
verzweifeln
lassen
könnte,
an
dieser
Welt,
an
ihrer
Sprache.
?Bei
all
seiner
großen
Flexibilität
ist
das
Englisch
paradoxerweise
eine
rigide
Sprache?,
liest
man
-
eine
willkommene
Abwechslung
im
lauten
Rechtschreibreform-Gedudel
heute:
?Es
ist
eine
Sprache,
in
der
sich
ein
Minimum
an
Gedanken
am
schnellsten
und
mit
einem
Minimum
an
Wissen
mitteilen
läßt
. . .
Deshalb
ist
das
Englische
die
lingua
franca
der
Wissenschaft,
die
allgemein
gebrauchte
Sprache
in
Politik
und
Wirtschaft.
Wahrscheinlich
haben
noch
nie
in
der
Geschichte
sich
so
viele
Leute
einer
Sprache
bedient,
deren
Literatur
zu
lesen
ihnen
völlig
unmöglich
ist.
?
Mit
diesem
Satz
wäre
alles
gesagt,
ist
das
Dilemma
benannt.
Poesie
kommt
vor
jeder
Wissenschaft
für
Erwin
Chargaff.
Sein
Buch
kommt
sehr,
sehr
spät,
aber
vielleicht
hat
die
Zeitverschiebung
ihm
ganz
gut
getan
-
seine
betuliche
Ruhe
lässt
die
Hektik
der
Diskussionen
heute
besonders
aggressiv
erscheinen.
Man
könnte
das
Buch
lesen
als
das
Werk
eines
Souffleurs
des
zwanzigsten
Jahrhunderts.«Fritz
Göttler
(Süddeutsche
Zeitung,
12.08.2000)