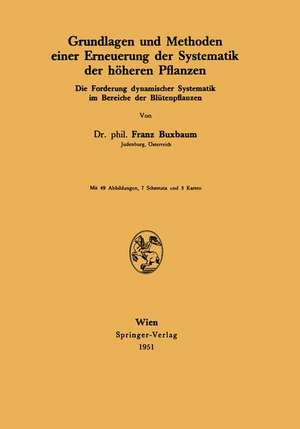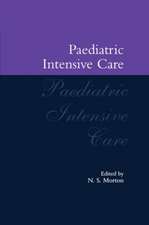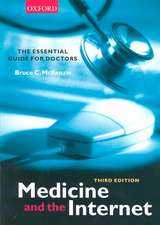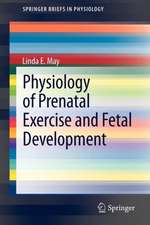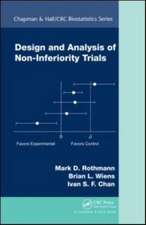Grundlagen und Methoden einer Erneuerung der Systematik der höheren Pflanzen: Die Forderung dynamischer Systematik im Bereiche der Blütenpflanzen
Autor Franz Buxbaumde Limba Germană Paperback – 31 dec 1950
Preț: 399.19 lei
Preț vechi: 420.20 lei
-5% Nou
Puncte Express: 599
Preț estimativ în valută:
76.39€ • 79.30$ • 63.70£
76.39€ • 79.30$ • 63.70£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 22 martie-05 aprilie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783211801970
ISBN-10: 3211801979
Pagini: 240
Ilustrații: XII, 224 S.
Dimensiuni: 170 x 244 x 13 mm
Greutate: 0.39 kg
Editura: SPRINGER VIENNA
Colecția Springer
Locul publicării:Vienna, Austria
ISBN-10: 3211801979
Pagini: 240
Ilustrații: XII, 224 S.
Dimensiuni: 170 x 244 x 13 mm
Greutate: 0.39 kg
Editura: SPRINGER VIENNA
Colecția Springer
Locul publicării:Vienna, Austria
Public țintă
ResearchCuprins
Erster Teil Einleitung.- 1. Die Ursachen des Verfalles der Systematischen Botanik.- Frühere Ansichten über die Ursachen 1. — Kritik der Meinung, die Systematik sei eine „abgeschlossene Wissenschaft“ 2. — Einige charakte, ristische offene Probleme 3. — Die wahren Ursachen 6..- 2. Systematik, Phytographie und Floristik.- Aufgabe und Art der Tätigkeit der Phytographie 8. — Aufgabe und Art der Tätigkeit der Systematik 8. — Anforderungen an den Systematiker 10. — Anforderungen an den Phytographen 10..- 3. Mängel in der Phytographie.- Zersplitterung der Arten 12. — Ungleichmäßige Auffassung des Gattungsbegriffes 13..- 4. Morphologie und Terminologie.- Ursachen der ungleichen und fehlerhaften Fassung des Gattungsbegriffes 14. — Falsche Literaturangaben 15. — Verfall der Morphologie 15. — Unzulänglichkeit der Terminologie 15. — „Phylogenetische“ und „idealistische“ Morphologie 18..- 5. Wege zur Erneuerung.- A. Artsystematik.- Geographische Grundlagen 21. — Beeinflussung durch ökologische Faktoren 21. — Feststellung der Variationsbreite 22. — Genetische Bearbeitung 22..- B. Systematik der Höheren Kategorien. Die „dynamische Methode“.- Reform der Terminologie 23. — Morphologische Bestandsaufnahme 24. — Ähnlichkeitssystematik — Dynamische Systematik 24. — Heranziehung aller botanischen Disziplinen 24..- Zweiter Teil Grundlagen der Systematik.- Erstes Kapitel. Der Typus-Begriff in der modernen Morphologie.- 1. Niedergang der Morphologie und ihre Ursachen.- 2. Mannigfaltigkeit und Einheit im Bau der Höheren Pflanzen.- Dreiteilung in Wurzel, Sproß und Blattorgane 27. — Gesetzmäßigkeit der Lage 27. — Offenes und geschlossenes Wachstum 28. — Wesen des offenen Wachstums 28. — Wachstumseinheiten 28..- 3. Gesetzmäßigkeit der Modifikationen.- Wachstumserscheinungen. — Hemmungserscheinungen. — Verzweigungswinkel. — Laterale, longitudinale und schraubige Symmetrie. — Farbstoffverteilung..- 4. Die Grundidee des „Typus“.- 5. Das Verhältnis der realen Formen zum generellen Typus.- Reihentypus 32. — Familientypus 33. — Gattungstypus 33. — Fortschreiten des Typus im Laufe der Höherentwicklung einer systematischen Einheit 35..- 6. Gesetzmäßigkeit der Progressionen.- 7. Gesetzmäßigkeit der Gestalt.- Kritik der „Zweckmäßigkeitslehre“ 37. — Kritik der „Anpassungslehre“.- Zweites Kapitel. Die Progressionen.- 1. Einleitung.- Konstanz der Erbmasse und Mutation 39. — Relative Häufigkeit der Mutationen 39. — Alte und junge Formen, Brückenformen 40. — Arten der Höherentwicklung durch Gen-Änderung 41..- 2. Der Begriff „Progression“.- Reduktive Progressionen 42. — Rudimentation. Abortus durch Rudimentation. Abortus durch Meiomerie 43. — Transformation. Transformierende Rudimentation 43..- 3. Progression und Typus.- Gerichtete und richtungslose Progression 44..- 4, Progressionsverzweigung und Progressionskreuzung.- Gerichtete und richtungslose Progression in bezug auf den Typus 47. — Verbindung verschiedener Entwicklungstendenzen 48. — Züchtung „artificieller Arten“ 50. — Die Arten der Zwischenformen 51..- 5. Umkehr durch Progression.- Drittes Kapitel. Die Mannigfaltigkeitszentren.- Beeinflussung der Mutationsquote 57. — Typusbegriff und Mutationsbereitschaft. Entstehung polymorpher Gattungen 58. — Entstehungspunkt und Mannigfaltigkeitszentrum 58. — Überschneidung der Areale 59. — Disjunkte Areale 59. — Klimaänderung und Klimaübergänge als mutationsauslösende Faktoren 59. — Progression und geographische Entwicklungsstraßen 61. — Wirkung des Ost-West-Verlaufes von Gebirgen 64. — Refugialgebiete 64. — Wirkung des Nord-Süd-Verlaufes von Gebirgen 65. — Interglacialzeiten und Rückwanderung 65. — Begriff „Mannigfaltigkeitszentrum“ 66. — Wanderungen der Tier- und Pflanzenwelt 66. — Großrefugien 67. — Invasionsgebiete 68. — Allelarme Kleinpopulationen der Randgebiete 68. — Allelverarmung in Invasionsgebieten, insulare Arten 69. — Multiple Gene und geographische Merkmalsprogressionen 69..- Viertes Kapitel. Die Selektion.- 1. Einleitung.- Modellreihe der Entstehung einer „Gattung“ 70. — Reine Linie 70. — Population 70. — „Formenschwartn“ 71. — Auflösung in „Arten“ 71. — Verminderung der Zwischenformen 71. — Gattung 71. — Auswirkungen der Selektion auf die Artgestaltung und in der Phylogenie der Gattung 71. — Die Selektion kein formbildender, sondern ein formvermindernder Faktor 71. — Die „ökologische Potenz“ in der kaltgemäßigten und in der feuchtwarmen Zone 71..- 2. Ökologische und Konkurrenz-Selektion.- Wirkung der ökologischen Selektion 72. — Ökotypen 72. — SaisonDimorphismus 72. — Hoch- und Tieflandsformen 72. — Konkurrenz-Selektion 72. — Wettbewerb der Artgenossen 72. — Wettbewerb mit anderen Arten desselben Biotyps 72. — Konkurrenz-Selektion und Einschlepplinge 72. — Fixierung durch Selbstbestäubung 73. — Fixierung ungünstiger Eigenschaften durch Autogamie 73..- 3. Relativität des Selektionsfaktors.- Selektionsfaktor, Klima und Areal 73. — Selektionsfaktor und Feuchtigkeitsfaktor 74. — Selektionsfaktor und Verbreitungsgrenze des spezifischen Bestäubers 74. — Verluste durch Selektion 75. — Selektion und Invasionsgebiete 75. — Klimarückschläge 76. — Veränderung des Selektionswertes am gleichen Standort 76. — Auswirkungen von Änderungen des Temperaturfaktors 76..- 4. Die verschiedene Breite des Selektionswertes.- Wirkung eines engen Selektionskoeffizienten 77. — Wirkung eines weiten Selektionskoeffizienten, Kosmopoliten 78. — Habituelle Variabilität von Kosmopoliten als Folge eines weiten Selektionskoeffizienten 78. — Konkurrenz-Selektion und Vermehrungskraft 79. — Samenvermehrung, vegetative Vermehrung und Mannigfaltigkeit 79. — Vegetative Vermehrung und Konkurrenz-Selektion 80..- 5. Die Tatsachen der Selektion in bezug auf die Systematik der höheren Kategorien.- Ausgangspunkt und Zerfall von „Formenschwärmen“ 80. — Artumgrenzung 81. — Übergang in andere Klimazonen 81. — Arealdisjunktionen und morphologische Disjunktionen 81..- Fünftes Kapitel. Variabilität.- 1. Der Variabilitätsbegriff.- Falsche Verbindung des Variabilitätsbegriffes mit dem Artbegriff 81. — Erweiterter Begriff „Variabilität“ 82. — „Mannigfaltigkeit“, die Variabilität, bezogen auf höhere Kategorien 82. — Umfang der Variationsbreite und der Faktor „Zeit“ 82. — Modell der Variationsbreite 82. — Mutative und adoptive Variabilität 83. — Kritik der Ausdrücke „varietas“ und „modificatio“ 83..- 2. Die genotypische und biotypische Variationsbreite innerhalb der Artpopulation.- „Ökologische Variabilität“, ökologische Rassen 85. — Variationsbreite und das „ökologische Relativitätsgesetz“ 86..- 3. Fluktuierende und disjunkte Variabilität innerhalb der Artpopulation.- Ursachen von Disjunktionen in der Variabilität 89. — Echter und Pseudovikarismus. Vierhappers Einteilung der Substitution 89. — Bedeutung der Variationsstatistik 92. — Saisondimorphismus 92. — Saisondimorphismus im Rahmen der Variabilität 92. — Scheinbare und echte Disjunktionen infolge ökologischer Faktoren 94..- 4. Variabilität der höheren Kategorien.- Ursachen der „Gattungs“-Entstehung 95. — Variationsbreite der Gattungen und höheren Kategorien, scheinbar Bindeglieder 95..- Sechstes Kapitel. Die Behandlung der Familie.- Die genetisch falsche zentrale Stellung des Artproblems in der bisherigen Systematik 96. — Die Familie — eine Realität 97. — Grundursachen falscher Familienumgrenzungen 97. — Über die „Zweckmäßigkeit“ phyletisch falscher Familienumgrenzungen nach augenfälligen Ähnlichkeitsmerkmalen 98. — „Ähnlichkeits“-Querverbindungen anstatt natürlicher Verwandtschaft 98, — Aufzählung statisch erfaßter Merkmale ist nicht zur Charakterisierung der Familie geeignet 99. — Die Familie ist zu charakterisieren durch den morphologischen Familientypus 99. — „Charactcra generalia“ und „Progressiones typicae“ 99. — Ergänzung der Diagnose durch einen „Conspectus“ 99. — Innere Gliederung der Familie 99..- Siebentes Kapitel. Die Behandlung der Gattung.- Bisherige Gattungsdefinition auf statischer Grundlage 101. — Neue Definition der Gattung 101. — Das „Genus primordioides“ die „Genera primitiva“ und „Genera progressiva“ 102. — Die morphologischen Progressionen — Funktionen des Familientypus; Entsprechung der morphologischen mit den geographischen Progressionen 103. — Die geographischmorphologische Methode in der Gattungssystetnatik 104. — Diskontinuität der Areale 104. — Kosmopolitische Genera 105. — Große oder kleine Gattungen? 105. — Echte monotypische Gattungen 106. — Falsche monotypische Gattungen 106. — Gattungsabgrenzung bei geradliniger stufenweiser Progression 107. — Grundsätze zur Gattungsabgrenzung bei fluktuierenden Übergängen 107..- Achtes Kapitel. Das Artproblem.- I. Ursachen der Schwierigkeit des Artproblems,,.- 1. Der Artbegriff — eine Fiktion.- „Gute Arten“ und Formenschwärme 108..- 2. Ungleichheit des Materials.- Stolen der Materialgrundlage 110. Genetische Durchforschung 111. — Standortbeohachtung und Variationsstatistik; genetische Mannigfaltigkeit und natürliche Formenmannigfaltigkeit 111. — Herbarmaterial 112. — Vorgetäuschte Disjunktionen 113. — Weiter Artbegriff bei überseeischen Formen 113..- 3. Die Frage der Erblichkeitsgrundlagen ins Artproblem.- A. Ist die Species reinerbig?.- B. Scheinbare Rcinerbigkeit (Morphologische Konstanz).- Heterocygotie nur in funktionellen (ökologischen) Eigenschaften 115 — Heterocygotie mit einem Letalfaktor 116. — Scheinbare Konstanz in Populationen 116. — Scheinbare Konstanz durch Allelschwund in Randpopulationen 116..- C. Intersterilitätsbarriere und Parasterilität.- Parasterilität, Intrasterilität und Intersterilität 117. — Sterilitätsbarriere durch. Autopolyploidie 117..- D. Artbastarde auf heteropolyploider Basis.- E. Phänokopien.- II. Zweck des Artbegriffes.- 1. Schaffung einer Ordnung und Übersicht.- 2. Internationale Verständigungsmöglichkeit.- 3. Floristik, Pflanzengeographie.- Die Kleinräumigkeit Europas 120. — Überseeische Formen 121. — Geobotanische Fragen — Artstatistik 121..- 4. Systematik der höheren Kategorien (Phylogenetik).- Phylogenetische Bedeutung einheitlicher Artengruppen 122. — Arten mit Riesenarealen 122. — Sektionen als systematische Einheiten 123..- 5. Experimentell ökologische und genetische Forschung.- 6. Weitere Argumente für weiten Artbegriff.- Enger Artbegriff kann nicht konsequent durchgeführt werden 124. — Ungesundes Artspezialistentum 124..- III. Definition und Behandlung des Artbegriffes.- Definition 124. — Unterteilung der Art in „Ökotypen“ und „Geotypen“ 125. — Kritik der neuen Vorschläge 125. — Wann ist eine Artumschreibung richtig? Einheit der Abstammung, Unterscheidbarkeit 125. — Zweckmäßigkeit der neuen Umschreibung 125. — Die Frage der Durchführbarkeit 126. — Unzulänglichkeit der heutigen phytographischen Unterlagen. Fehlen der Kenntnis der genotypischen Variationsbreite 127. — Mangelnde Kenntnis der Mannigfaltigkeitszentren 127..- IV. Eine Interimslösung.- Dritter Teil Die Methodik.- Erstes Kapitel. Die Vorarbeiten.- 1. Einleitung.- 2, Phytographische Vorarbeiten.- Übersicht über die zu bearbeitenden Formenkreise 130. — Aus der Reihe springende Gattungen, Literaturlücken 130..- 3. Arealgeographische Vorarbeiten.- 4. Materialbeschaffung.- Fixieren und Transport fixierten Materiales 135. — Anforderung an das Material 135. — Samensammlung 136..- 5. Literaturvorarbeiten.- a) Phytographische Literatur 136. — b) Allgemeine Literatur 137. e) Abbildungen 138. — Mängel des Bildmaterials 139..- Zweites Kapitel. Die morphologische Analyse.- 1. Grundsätzliches.- Morphologischer Typus und „Ähnlichkeit“ 141. — Morphologische Vorschulung 141. — Zeichnendes Festhalten der Analysenbefunde 142..- 2. Überblick über die Gattungen.- Monotypische Gattungen 142. — Polymorphe Gattungen 143. — Gattungen mit großen Arealen 143. — Arten isolierter Standorte 143. — Typische Individuen, „Epitypus“ und „Hypotypus“ 143. — Terata 145. — Samen 145. — Keimlinge 147..- 3. Das Material.- A. Frischmaterial.- Einige wichtige technische Kniffe: Feststellen des empfängnisfähigen Teiles der Narbe 149; Verlängerung gestauchter Internodien zwecks leichterem Überblick durch Dunkelkultur 149; Brüchigkeit fleischiger, stark turgeszenter Organe 149; aufgesprungene entleerte Antheren 150; undeutliche Organkonturen 150; pflanzliche Schleime 150; harte Objekte 150; Durchsichtigmachen 151; Nervatur der Büitenhiillblätter 151; Blütenlängsschnitte 152..- B. Herbarmaterial.- Grundsätzliches bei Arbeiten mit Herbarmaterial 153. — Behandlung von Herbarbruchstücken 154..- 4. Die „Morphologische Monographie“.- A. Der Arbeitsgang.- Das Zeichnen 154. — Das „Erkennen des Typus“ 154. — Zweckmäßiger Arbeitsgang 155..- B. Die Auswertung.- Progressionsreihen der einzelnen Organe 157. — Abweichende Stellung einzelner Arten oder Artgruppen 158..- C. Die Bautypen.- D. Die Bautypen des Gynöceums.- a) Beweise für die Blattnatur der Carpelle.- Gefäßbündelverlauf 160. — Wachstumsverteilung 160. — Nervatur der Carpellspreite 161..- b) Die Carpellform.- Das peltate Carpell 163. — Das epeltate Carpell 164..- c) Die Anordnung mehrerer Carpelle in der Blüte.- Apocarpie — Coenocarpie 165..- d) Die Plazentation.- e) Die Beteiligung der Achse am Aufbau des Gynöceums.- Zentraler Achsenkegel bei coenocarpem Gynöceum 171. — Beteiligung des Achsenkegels bei apocarpem Gynöceum (Pseudocoenocarpie) 172. — Achsenberindung 172. — Achsenkegel in Verbindung mit Achsenberindung 172. — Pseudohypogynie 173. — Pseudoepigynie 173..- f) Pseudomonomerie.- E. Die neue Diagrammatik der Blüte.- Mängel der bisherigen Diagrammatik 175. — Erläuterung der Diagramme 177. — Das Längsschnittschema 184. — Längsschnittbild und Längsschnittschema 184. — Erläuterung der Längsschnittschemata 185..- Drittes Kapitel. Entwicklungstendenzen, Tendenzmerkmale und ihre Auswertung.- 1. Progressionsreihen.- Reihenskizzen der einzelnen Organe 187. — Gegensätzliche Entwicklungstendenzen (Progressionsverzweigung) 189. — Abbrechen einer Progressionsreihe 189. — Heranziehung geographischer Indizien 190. — Klimagrenzen 190. — Berührungszonen und Übergangsformen 190..- 2. Tendenzmerkmale.- Definition des Tendenzmerkmales 192. — Mannigfaltigkeit des habituellen Erscheinungsbildes eines Tendenzmerkmales 192..- 3. Mängel im Material.- Überbrückung von Kenntnislücken 195. — Überbrückung durch Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten. Die „dynamische Methode“ 195. — Behandlung einer systematischen Einzelfrage mit unvollständigem Material 196..- Viertes Kapitel. Auswertung der geographischen, klimatologischen und geologischen Tatsachen.- Zweck der geographischen, klimatologischen und geologischen Erhebungen 198. — Die kartographische Arealaufnahme 198. — Lage des Mannigfaltigkeitszentrums — tabellarische Festlegung 199. — Geographische Merkmalsprogressionen: a) innerhalb der Art infolge multipler Allelic bei Artpopulationen; b) geographische Progressionen hei höheren Kategorien 200. — Geographische Kontrolle der morphologischen Entwicklungslinien 201. — Klimatologische Untersuchungen 201. — Klimadiagramm und Vegetationsrhythmus 201. — Geologische Tatsachen und Wanderungswege 202..- Fünftes Kapitel. Die Synthese.- 1. Ergebnisse der analytischen Arbeiten.- Der morphologische Typus der bearbeiteten Kategorie 203. — Zusammenschluß typologisch einheitlicher Gruppen 204..- 2. Die Wertigkeit der Merkmale.- 3. Die Phylogenetische Gruppenbildung.- Das „Genus primitivum“ und Hauptprogressionsrichtungen (Genera progressiva) 209. — Bewertung verschieden gerichteter Progressionen der einzelnen Organe 209. — Wertung der Merkmale 210. — Kennzeichen der höheren Entwicklungsstufe 211..- 4. Ausarbeitung der Entwicklungslinien der einzelnen Formenkreise.- Grundsätzliches 211. — Der „Stammbaum“ 212. — Falsche und richtige graphische Darstellungsform 212..- 5. Zusammenfügen der einzelnen Entwicklungslinien zu einem Gesamtstammbaum.- Überprüfung der isolierten Gattungen auf Grund der ermittelten Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten 213. — Vergleich der Areale 214. — Formen mit besonderen Progressionen 214. — Formen in Mittelstellung 215. — Mittelstellung in höheren Kategorien 215. — Fall 1. Echte Übergangsform einer Entwicklungsreihe 215. — Fall 2. Progressionsverzweigung 216. — Fall 3. Konvergenzerscheinung 217. — Feststellung der primitivsten Gruppe 218. — Schrittweiser Aufbau der Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen 218. — Übergang zu einer höheren Unterfamilie 218. — Beispiel eines „Stammbaumes“ 219..- 6. Die lineare Anordnung der Gattungen auf Grund des Stammbaumes.- Erläuterungen am Stammbaum-Beispiel 220. — Behandlung der Abzweigungsstellen einer höheren Unterfamilie 220. — Behandlung mehrerer Höchststufen 221. — Auflösung bei Bearbeitung ganzer Reihen 223..- Schlußwort.