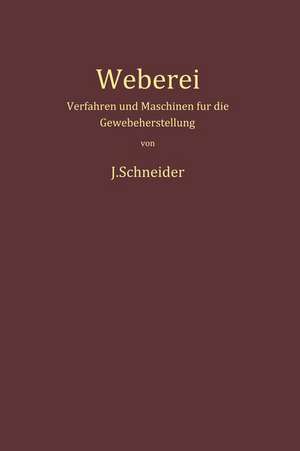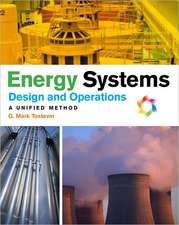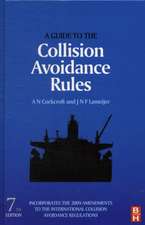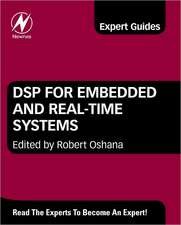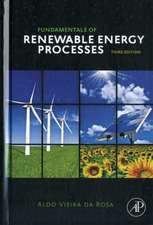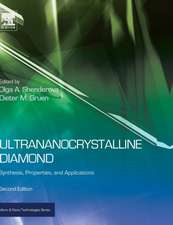Weberei: Verfahren und Maschinen für die Gewebeherstellung
Autor Josef Schneiderde Limba Germană Paperback – 6 iul 2012
Preț: 458.68 lei
Preț vechi: 539.63 lei
-15% Nou
Puncte Express: 688
Preț estimativ în valută:
87.78€ • 95.31$ • 73.73£
87.78€ • 95.31$ • 73.73£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 22 aprilie-06 mai
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783642490637
ISBN-10: 3642490638
Pagini: 500
Ilustrații: XII, 484 S. 601 Abb.
Dimensiuni: 178 x 254 x 26 mm
Greutate: 0.86 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1961
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3642490638
Pagini: 500
Ilustrații: XII, 484 S. 601 Abb.
Dimensiuni: 178 x 254 x 26 mm
Greutate: 0.86 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1961
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchDescriere
Das vorliegende Handbuch vermittelt die Kenntnis der Verfahren und Maschi nen für die Gewebeherstellung, es wendet sich an die Textilindustrie und an den Textilmaschinenbau. Die vorbereitenden Verfahren, Maschinen und Aggregate hat der Verfasser für die gleichen Fertigungsgebiete in dem 1955 im Springer Verlag erschienenen Werk" Vorbereitungsmaschinen für die Weberei" abgehandelt. Wie im ersten Werk hat sich der Verfasser in dem jetzt vorliegenden Buch "Weberei" bemüht, bei der Gestaltung die Interessen des textil-und maschinen technischen Bereiches zu berücksichtigen. Wo es notwendig erschien, wurden die Probleme unter beiden Gesichtspunkten abgerundet behandelt. Der Beschluß des Normenausschusses, künftig für alle mechanischen Webstühle den Begriff "Webmaschinen" einzuführen und die Bezeichnung "Webstuhl" nur noch für Handwebstühle zu verwenden, erfolgte im Dezember 1960 kurz vor dem Erscheinen dieses Buches, seine allgemeine Berücksichtigung erfolgte daher nicht. Wie man aus der Vorbemerkung zu Kap. B. : "Die mechanischen Web stühle bzw. Webmaschinen" erkennt, teilt der Verfasser die durch den Beschluß zutage getretene Auffassung, nach der bei den Webmaschinen die Wahl einer der beiden Bezeichnungen keine Güteklassifizierung bedeutet. Man wird indessen, da man Wert darauf legen muß, von den Fachleuten immer richtig verstanden zu werden, vorläufig noch nicht in allen Wortverbindungen den eingeführten Begriff "Webstuhl" durch "Webmaschine" ersetzen können. Mit Rücksicht darauf, daß auch im Ausland für Webstuhl und Webmaschine nur eine Bezeich nung gebräuchlich ist (metier a tisser, 100m), werden in diesem Werk beide Bezeichnungen in gleicher Bedeutung nebeneinander und auch durcheinander verwendet.
Cuprins
A. Einleitung.- 1. Gewebe und Bindung.- 2. Arbeitsgänge in der Webereivorbereitung.- 3. Das Weben.- 4. Die Schematik des Webstuhles.- B. Die mechanischen Webstühle bzw. Webmaschinen (Typisierung).- I. Flachwebstuhl.- 1. Baumwollwebstuhl.- 2. Reyon-Webstuhl.- 3. Tuchwebstuhl („Kurbel-Buckskin-Stuhl“).- 4. Webstühle mit Jacquardmaschinen.- 5. Filztuchwebstuhl.- 6. Frottiertuchwebstuhl.- 7. Plüschwebstuhl.- 8. Doppelteppich-Webstuhl.- 9. Greiferschützen-Webstuhl.- a) Sulzer-Webstuhl.- 1. Betrachtung zum Webbereich der Webmaschine.- 2. Personalbedarf.- 3. Textile Vorbereitung.- 4. Kante.- b) Neumann-Webstuhl.- 10. Greifer-Webstuhl.- a) Webstuhl von Gabler.- b) Der Greifer-Webstuhl, Type Ancet-Fayolle.- c) DEWATEX-Webstuhl.- d) Webstuhl von Ripamonti.- e) Thoumire-Webstuhl.- f) Tumack-Webstuhl.- 11. Der Düsenwebstuhl.- a) Maxbo-Webstuhl.- b) Kovo-Webstuhl.- II. Der Rundwebstuhl.- 1. Die Entwicklung des Rundwebstuhles.- 2. Prinzip der Arbeitsweise.- 3. Prinzip des Schützenantriebes.- C. Die Schaltung von Kette und Ware.- I. Kettablaßvorrichtungen.- 1. Nicht automatisch regelnde Kettbaumbremsen.- a) Die Seilbremse.- b) Die Kettenbremse.- c) Bandbremsen sowie Band- und Muldenbremsen.- 1. Die Bandbremse.- 2. Die Band- und Muldenbremse.- d) Richtlinien für die Praxis.- 1. Einhalten der richtigen Schußdichte.- 2. Kettspannung und Schußdichte.- 3. Kettbaumbremse zur Herstellung von flüchtig eingestellten leichten bis mittelschweren Geweben mit geringer Kettspannung.- 4. Das Abbremsen der Kettbäume beim Abweben von mehr als einem Kettbaum.- 2. Automatisch regelnde Kettbaumbremsen.- a) Differential-Band- und Muldenbremse.- Automatische Bremse am ASTRA-Webstuhl.- b) Differential-Bandbremse.- c) Die Kurtz-Bremse.- 3. Kettschaltwerke — sog. KettablaBregulatoren.- a) Negativ schaltende KettablaBregulatoren.- 1. Negatives Kettschaltwerk am Tuchwebstuhl.- 2. Negatives Kettschaltwerk von Saurer.- 3. Negativ arbeitendes Schaltwerk von Jaeggli.- b) Positiv schaltende KettablaBregulatoren.- c) Kombiniert positiv und negativ arbeitende KettablaBregulatoren.- II. Warenaufwindevorrichtungen (Warenbaumregulatoren).- 1. Klassifizierung der Warenbaumregulatoren an prinzipiellen Darstellungen.- a) Formschlüssig wirkende Warenbaumregulatoren.- b) Intermittierend wirkende Warenbaumregulatoren.- c) Kraftschlüssig wirkende Warenbaumregulatoren.- 2. Die Wirkungsweise der Warenbaumregulatoren und deren Anordnung.- a) Formschlüssige stetig schaltende Warenbaumregulatoren.- 1. Stirnradübersetzung — Schneckenradübertragung.- 2. Direkt wickelnde — indirekt wickelnde Warenbaumregulatoren.- 3. Räderwechsel — Schalthubwechsel.- b) Formschlüssig, intermittierend schaltende Warenbaumregulatoren.- c) Kraftschlüssig schaltende Warenbaumregulatoren.- 1. Wirkungsweise bei aktivem Kettablaß.- 2. Wirkungsweise bei passivem Kettablaß.- d) Die Umstellung von formschlüssiger auf kraftschlüssige Schaltung oder umgekehrt.- e) Das Aufwickeln der Ware.- f) Hinweise für die Konstruktion und Bedienung der Schaltwerksteile.- g) Die Berechnung des Wechselrades für den formschlüssig, stetig schaltenden und indirekt wickelnden Regulator.- h) Abstellvorrichtung für Musterlängen am Warenbaumregulator (ASTRA).- 3. MaximalschuBdichte und Garndurchmesser.- a) Die Größe der notwendigen Streichbaumbewegung.- b) Das Walken von Kett- und SchuBfäden.- D. Musterungsvariation durch Fachbildung.- I. Grundzüge der Bindungslehre.- 1. Grundbindungen.- a) Tuchbindung.- b) Köper.- c) Atlas.- 2. Farbeffekte der Grundbindungen.- 3. Abgeleitete Bindungen.- a) Rips.- b) Kautschukbindungen.- c) Panama.- 4. Musterung durch Einzüge.- Einzüge nach DIN 61110.- II. Die Fachbildung.- 1. Geometrie und Dynamik der Fachbildung.- 2. Arten der Fachbildung.- 3. Die Reibung der Kettfäden im Litzenauge.- 4. Kraftschlüssige und formschlüssige Schaftbewegung.- 5. Teilstäbe im Hinterfach.- Die Anordnung der Kreuzstäbe (auch Ruten genannt) im Hinterfach.- 6. Der Zeitpunkt des Fachumtrittes.- III. Elemente und Aggregate zur Bildung des Faches.- 1. Schaftbewegung durch Exzenter.- a) Innentrittvorrichtung.- b) Die Außentrittvorrichtung.- c) Trommelwebstühle.- Die Konstruktion des Exzenters.- d) Das Trittelieren der Schäfte.- e) Exzentertrittvorrichtungen für oberbaulose Webstühle.- f) Taffettrittvorrichtungen in oberbauloser Form.- g) Innentrittvorrichtungen in oberbauloser Form.- h) Außentrittvorrichtungen in oberbauloser Konstruktion.- i) Der Obertritt.- k) Außentrittmaschine.- l) Die Reparaturanfälligkeit der Exzentertrittvorrichtungen.- 2. Schaftbewegung durch Schaftmaschinen.- a) Die Gliederung der Schaftmaschinen.- b) Einhubschaftmaschinen — Doppelhubschaftmaschinen.- c) Die Haupttypen von Schaftmaschinen.- d) Neuzeitliche Schaftmaschinen.- 1. Hattersley-Schaftmaschine.- 2. Die Schaufelschaftmaschine.- 3. Schaftmaschinen für die Wollindustrie.- e) Oberbaulose Webstühle.- Die Fachbildung bei oberbaulosen Webstühlen.- f) Das Webgeschirr.- 1. Der Schaft.- 2. Die Litzen.- 3. Die Aufhänge- und Niederzugelemente.- 3. Jacquardmaschine.- a) Technische sowie technologische Gruppierung der verschiedenen Jacquardmaschinentypen.- 1. Jacquardmaschinen für Hochfach.- 2. Jacquardmaschinen für Hoch- und Tieffach.- 3. Das Doppelhub-Prinzip.- 4. Die Schrägfachjacquardmaschine.- 5. Jacquardmaschinen für spezielle Gewebe.- 6. Verdolmaschinen.- b) Die Betriebssicherheit der verschiedenen Kartensysteme.- c) Die Jacquardmaschinentypen.- 1. Jacquardmaschinen für Hoch- und Tieffach.- 2. Jacquardmaschine für Schrägfach.- 3. Halboffenfach-Jacquardmaschinen.- 4. Gegenüberstellung der Hoch- und Tieffach-Jacquardmaschine mit der Doppelhub-Jacquardmaschine.- 5. Offenfach-Doppelhub-Jacquardmaschine.- 6. Die Jacquardmaschine mit Verdol-Vornadelwerk.- d) Die Drehzahl der Jacquardmaschine.- e) Konstruktion und Arbeitsweise moderner Jacquardmaschinen.- 1. Doppelhub-Halboffenfach-Jacquardmaschinen.- 2. Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine.- f) Der Harnisch.- Harnischeinzüge oder Gallierungen.- E. Musterungsvariation durch Schußwechsel.- 1. Die Einstellung des Kastens.- 2. Die Einstellung des Wechsels.- Das Wechselverhältnis — Wechselschema.- Getriebe zur Durchführung der Wechselkastenbewegung.- 1. Der Revolverwechsel.- 2. Der Revolver-Úberspringer.- 3. Schützenwechselkastenbewegung durch Zahnradgetriebe (Knowlesgetriebe).- a) Elementarform des Knowlesgetriebes.- b) Die konstruktive Gestaltung des Getriebes.- 1. Wirkungsweise des Schönherr-Wechsels am Webstuhl Modell C und B.- 2. Der Wechsel am SG 4-Webstuhl.- 3. Der Wechsel am Hartmann-Kurbelwebstuhl.- c) Vergleicher de Betrachtung der Knowles-Wechselgetriebe am Schönherr-Webstuhl und am ASTRA-Webstuhl.- d) Zweiseitig vierkästiger Schützenwechsel des ASTRA-Webstuhles.- e) Zweiseitig fünfkästiger Wechsel.- f) Zweiseitig vierkästiger Schützenwechsel von Schönherr.- 4. Schützenwechselkastenbewegung durch Exzenter.- a) Die Elementarform der Steuerung des Wechselkastens durch Kreisringexzenter.- b) Steuerung zweier getrennt auf Wellen gelagerter Kreisringexzenter.- c) Kartenschlagregel.- F. Lade, Ladenantrieb und Schützenantrieb.- I. Lade.- a) Einfluß der Ladenbewegung auf die Gleichmäßigkeit der Webstuhldrehzahl.- b) Ladenbewegung bei der Herstellung von Frottierwaren.- Webtechnische Voraussetzungen.- c) Das Webeblatt.- 1. Webeblattberechnung.- 2. Die Blattstellung.- 3. Spezial-Webeblätter.- II. Eintragen des SchuBfadens in das Webfach.- 1. Mechanismen zum Eintragen des Schusses.- a) Schlagvorrichtungen als Schützenantriebsaggregate.- 1. Der Oberschlag.- 2. Der Unterschlag.- 3. Fingerschlag.- 4. Federschlag.- 5. Schlag am Kurbel-Buckskinstuhl.- 6. Schlag am Seidenstuhl.- 7. Parallelschlag.- b) Die Schlagsteuerungen.- 1. Positive Schlagsteuerungen.- 2. Negative Schlagsteuerungen.- 2. Antriebsorgane zum Eintragen des Schußfadens an „schützenlosen Webstühlen“ (shuttle-less-looms).- a) Eintragung des SchuBfadens durch Greiferschützen.- 1. Eintragen des SchuBfadens an der Sulzer-Webmaschine.- 2. Eintragen des Schußfadens bei der Webmaschine, System „Neumann“.- b) Das Eintragen des Schußfadens auf Greifer-Webstühlen.- 1. Die Engels-Greiftex-Webmaschine.- 2. Das System Thoumire.- 3. Der Tumack-Webstuhl.- 3. Musterungsmöglichkeit und Kantenbildung auf den schützenlosen Webmaschinen.- 1. Eintragen des Schußfadens durch Wasser oder Preßluft.- 2. Eintragen des Schusses durch ein elektromagnetisches Wanderfeld.- 4. Kinematische Analyse der Laden- und Schützenbewegung.- a) Die Ladenbewegung.- Das Ladendiagramm verschiedener Webstuhlkonstruktionen.- b) Die Schützenbewegung.- Die Bestimmung der Schützengeschwindigkeit.- c) Zweck und Art der Ladenbahnkrümmung.- Rechnerische Ermittlung der notwendigen Größe der Ladenbahnausbuchtung.- d) Die Flugbahn des Schützen.- 1. Die empirische Ermittlung der Flugbahn des Schützens.- 2. Berechnung der Schützengeschwindigkeit aus der Schützenlaufkurve.- 3. Rechnerische Ermittlung der Schützenlaufkurve.- 4. Schützenauffang.- 5. Der Picker.- a) Rohstoff, Lieferbedingungen und Vorbehandlung für Picker.- b) Die Ausführungsformen für Picker.- c) Der Pickerverschleiß.- d) Arbeitstechnische Folgen, die durch falsche Pickerführung bedingt sind.- 6. Webschützen.- a) Über den Verbrauch von Webschützen.- b) Die Auswahl der Webschützen.- c) Das Holz des Schützens.- 1. Der natürliche Verschleiß des Webschützens.- 2. Die Behandlung des Webschützens.- d) Ursachen und Folgen für das Herausfliegen des Schützens.- e) Das Kräftespiel am Webschützen.- 7. Breithalter.- G. Die Automatisierung des Webstuhles.- 1. Großraumschützen ein Programm der Automatisierung ?.- 2. Die Voraussetzung für die Automatisierung.- 3. Großraumschützen mit Superkopsen (Pirn-Kopse).- 4. Die wirtschaftliche Seite der Automatenweberei.- I. Pionierkonstruktionen des Automatenwebstuhles.- a) Die Entwicklung des Schützenwechselautomaten.- b) Die Entwicklung des Kopswechselautomaten.- 1. Eine Gefahr bei der Automatisierung.- 2. Die Zahl der Webautomaten pro Arbeitskraft.- 3. Die Bedeutung des Anbauautomaten.- II. Automaten.- a) Spulenwechselautomaten.- 1. Der Mischwechselautomat.- 2. Zweifarbenautomat.- 3. Vierfarben-Spulenwechsler.- 4. Sechsfarben-Spulenwechsler.- b) Der Schlauchkopswechselautomat.- c) Schützenwechselautomaten.- 1. Der Non-stop-Wechsler (Fliegender Schützenwechsel).- 2. Schützenwechsel bei Stillstand des Webstuhles.- d) Box-loader bzw. box-container und Loom-winder.- H. Kontroll- und Überwachungsvorrichtungen am Webstuhl.- I. Kettfadenbruchüberwachung am Webstuhl.- 1. Mechanische Kettfadenwächtervorrichtungen.- Unterschiede in der Ausführungsform.- 2. Der elektrische Lamellenwächter.- 1. Kettfadenwächter für Seide.- 2. Kettfadenwächter für Wollgarne.- 3. Der elektrische Lamellenwächter für Baumwolle.- 4. Schaltung und Stromführung bei elektrischen Lamellenwächtern.- 5. Einsatzfähigkeit des elektrischen Kettfadenwächters gegenüber dem mechanischen Fadenwächter.- 3. Der elektrische Geschirrwächter.- 1. Praktische Hinweise für das Kettfadenwächtergeschirr mit Kontaktlitzen.- 2. Der Vergleich des Geschirrwächters gegenüber dem Lamellenwächter.- II. Schußfadenbruchüberwachung am Webstuhl.- 1. Der Gabelschußwächter.- 2. Der Nadelschußwächter.- 3. Doppelschußwächter mit Exzentersteuerung.- 1. Schußwächtervorrichtungen am Seidenwebstuhl.- 2. Mittelschußwächter am Seidenwebstuhl von Zangs.- 4. Zentralschußwächter am Saurer-Webstuhl.- 5. Vorrichtungen zum SchuBsuchen.- Die Vorteile und Nachteile.- 6. Der selbsttätige mechanische Rücklauf.- Einstellungshinweise für den selbsttätigen mechanischen Rücklauf.- III. Überwachung der SchuBspule am Webstuhl.- 1. Konstruktive Voraussetzungen für Spulenfühler.- 2. Mechanische Spulenfühler.- a) Der Nadelfühler oder Stecherfühler.- b) Der Gabelfühler.- c) Der Abgleitfühler.- d) Der Differenzfühler oder Distanzfühler.- 3. Elektromechanische Spulenfühler.- Der Fühlvorgang.- 4. Der elektrische Spulenfühler.- Der Einbau von elektrischen Spulenfühlern.- 5. Optisch-elektrische Spulenüberwachung.- 6. Sonderkonstruktionen von Spulenfühlern.- a) Spulenfühler für Frottierwebstühle.- b) Spulenfühler für Lancierwebstühle.- c) Spulenfühler am Kurbel-Buckskin-Webstuhl.- d) Spulenfühler am Lancierwebstuhl für Seide.- 7. Der optisch-elektronische Spulenfühler.- IV. Die Überwachung des Schützenlaufes — die Pufferung.- 1. Die Wirkungsweise des Blattauswerfers.- 2. Die Wirkungsweise der Stecherwelle.- I. Der Antrieb der Webmasehine.