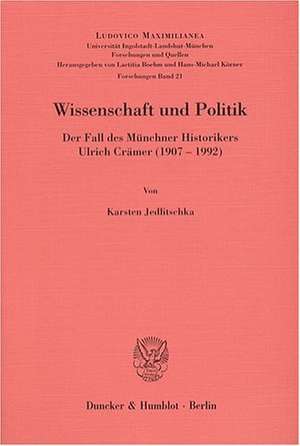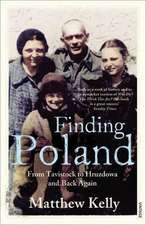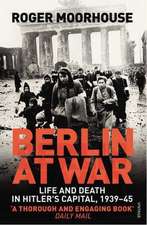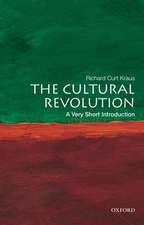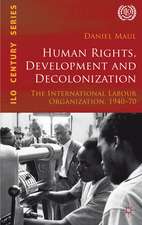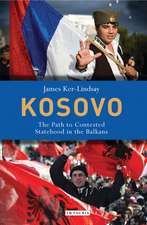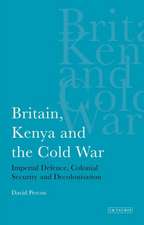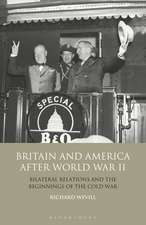Wissenschaft und Politik.
Autor Karsten Jedlitschkade Limba Germană Paperback – 22 mai 2006
Preț: 555.46 lei
Preț vechi: 624.11 lei
-11% Nou
Puncte Express: 833
Preț estimativ în valută:
106.30€ • 110.35$ • 88.64£
106.30€ • 110.35$ • 88.64£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 18-24 martie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783428118618
ISBN-10: 3428118618
Pagini: 488
Dimensiuni: 157 x 233 x 27 mm
Greutate: 0.74 kg
Ediția:1. Auflage
Editura: DUNCKER & HUMBLOT
ISBN-10: 3428118618
Pagini: 488
Dimensiuni: 157 x 233 x 27 mm
Greutate: 0.74 kg
Ediția:1. Auflage
Editura: DUNCKER & HUMBLOT
Recenzii
"[...] Jedlitschkas Untersuchung gründet auf der genauen und differenzierten Auswertung der einschlägigen Archivalien und Forschungen. Sie führt eindrucksvoll vor Augen, wie sich die deutsche Geschichtswissenschaft in das nationalsozialistische Herrschaftsgefüge verwickelte und welch nachhaltige Konsequenzen sich daraus für die Zeit nach 1945 ergaben." Helmut Zedelmaier, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 04.05.2009-12-12 "Fleißig, gegenwartsbezogen, SS-Mann Akademische Vergangenheitspolitik: Das Leben des Münchner Historikers Ulrich Crämer Biographien bedeutender Historiker des vergangenen Jahrhunderts haben gegenwärtig Konjunktur, heißen diese nun Gerhard Ritter, Hans Rothfels, Hermann Aubin, Theodor Mayer oder Percy Ernst Schramm. Ulrich Crämer würde man auf den ersten Blick nicht für biographiewürdig halten, da er zwar 1940 auf den prestigeträchtigen Lehrstuhl Karl Alexander von Müllers für Mittlere und Neuere Geschichte nach München berufen wurde, diesen aber nach Kriegsende wieder verlor, durch den in der NS-Zeit kaltgestellten Franz Schnabel ersetzt wurde und nie wieder in den Universitätsbetrieb zurückkehren konnte. Karsten Jedlitschka, der Leiter des Archivs der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle, untersuchte in seiner Münchner Dissertation Crämers Biographie als Exempel. Die Bedeutung der Vita beruht demnach nicht so sehr auf seinem wissenschaftlichen OEuvre als auf der Tatsache, daß er 1945 sein Professorenamt verlor und es in jahrelangen Prozessen nicht wiedererlangte. Die 'Causa' Crämer wurde so zum Lehrstück der 'akademischen Vergangenheitspolitik' an der Münchner Universität. In den Streitereien intervenierten der einstmals einflußreiche 'Verband der nicht-amtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer', die Vertreter der bayerischen Ministerialbürokratie (von Alois Hundhammer bis Johannes von Elmenau), die alten und neuen Kollegen Crämers an der Münchner Universität (Karl Alexander von Müller, Max Spindler, Franz Schnabel, Karl Bosl, Johannes Spörl) und selbst die damals noch lebenden Vertreter des nationalsozialistischen 'Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung' (Heinrich Harmjanz, Rudolf Mentzel). In zahlreichen Gutachten sollte bewiesen werden, daß Crämers Berufung aus politischen Gründen erfolgt sei. Dafür sprachen seine frühe SA- und SS-Mitgliedschaft, ein Referentenposten im Reichsinnenministerium, seine Rezensionstätigkeit bei der Parteiamtlichen Prüfungskommission und die Intervention der Parteikanzlei; dagegen eine nichtarische Urgroßmutter, sein Festhalten am Christentum und das Leumundszeugnis ehemaliger Hörer wie Sieglinde Ehards, der Frau des späteren Ministerpräsidenten. Crämer unterlag in allen Instanzen, stand am Ende ohne Gehalt und Titel da, sein Ansehen war ruiniert. Dabei ging es weniger um die Wissenschaft als um die Autonomie der Münchner Universität, wie sein einziger Förderer, der Münchner Romanist und Gegner des Nationalsozialismus, Hans Rheinfelder, treffend bemerkte: 'Wollte man in gleicher Weise, wie man es bei Crämer tut, auch die anderen Professoren unter die Lupe nehmen, dann müßte man gerechterweise heute noch Dutzende von viel schwerer belasteten, viel regelloser berufenen Professoren ihres Amtes entheben.' Am Ende mußte Crämer froh sein, im Verlag Brockhaus als Lektor unterzukommen. Zwar war er von 1966-1976 für den historischen Inhalt der Enzyklopädie zuständig und prägte das Geschichtsbild vieler Benutzer, doch empfand er dies als Abstieg. Er war ein fleißiger Historiker mit vielseitigen Projekten, die er geschickt den jeweiligen politischen Konstellationen anpaßte. So präfigurierte der absolutistische Staat in seinen Augen den nationalsozialistischen Machtstaat. Ähnlich interpretierte er in seiner Dissertation Straßburg als Muster einer 'deutschen Reichsstadt', in der dank einer ausgeklügelten Wehrverfassung 'Zucht und Sitte' herrschten. Wenn Crämer sich nach Kriegsende in Allgäustudien vertiefte, so sollten diese das Fundament für einen anvisierten Lehrstuhl für 'deutsche (und europäische) Landesgeschichte' oder 'historische Geographie' bilden, den es in München nicht gab. Für diese Anpassung findet Jedlitschka in seiner vorzüglich dokumentierten und spannend geschriebenen Untersuchung deutliche Worte. Er spricht von einer 'Transformation korrumpierter Fragestellungen in die Wissenschaft der frühen Bundesrepublik' und resümiert im Hinblick auf die NS-Zeit: 'Ulrich Crämer ist ein Paradefall eines gegenwartsorientierten Geschichtsinterpreten. Die politische Ausrichtung seines wissenschaftlichen Schrifttums ist nicht etwa akzidentiell im Sinne einer Anpassung an die Imperative des Regimes, sondern leitend in die Fragestellung und Interpretation'." Frank-Rutger Hausmann, in: Süddeutsche Zeitung, 06.03.2007 "Missbrauchte Historie Karsten Jedlitschkas Pionierstudie über die braune Vergangenheit der Münchner Universität Nach langem Zögern hat die deutsche Geschichtswissenschaft begonnen, sich ihrer braunen Vergangenheit zu stellen. Karsten Jedlitschka legt hier eine aufschlussreiche Pionierstudie für die Münchner Universität und ihre Historiker vor. Sich intensiv mit Ulrich Crämer zu beschäftigen bot sich aus mehreren Gründen an. Denn in den Höhen und Tiefen seiner Karriere vor und nach 1945 lassen sich beispielhaft wichtige Entwicklungslinien der Geschichtswissenschaft nachvollziehen. Die verwickelten Intrigen um Crämers Berufung auf das Ordinariat für Mittlere und Neuere Geschichte in München 1940 als Nachfolger Karl Alexander von Müllers erscheinen als Lehrstück für die Mechanismen der NS-Wissenschafts- und Hochschulpolitik. Sie liefern auch eine Erklärung dafür, warum der Nationalsozialismus gerade in der jüngeren Generation an den Universitäten relativ schnell hat Fuß fassen können. Der ehrgeizige Junghistoriker liefert mit seiner Biografie, seinem wissenschaftlichen Werk und seinen weit gefächerten Aktivitäten einen vom Autor sorgfältig und materialreich dokumentierten Musterfall für die unauflösliche Verschränkung von Wissenschaft und Politik, für die politische Instrumentalisierung der Geschichte als historische Legitimationswissenschaft und für die Wirkungsmacht politischer Netzwerke und Patronagen, im Fall Crämers bis hinauf zu Frick, Rust und Sauckel. Auch im umfangreichen zweiten Teil seiner Arbeit bettet Jedlitschka wieder überzeugend die individuelle 'causa Crämer', dessen hartnäckige, am Ende aber erfolglose Bemühungen bei der Fakultät, im Kultusministerium und schließlich bei den Gerichten um eine Wiedereinsetzung ins Amt nach seiner Entlassung 1945, ein in die 'akademische Vergangenheitspolitik' der Ära Adenauer. Hier ging es einmal um den Verzicht auf eine gründliche inneruniversitäre Aufarbeitung der Zeit vor 1945 in München und seine Hintergründe und zum anderen um die Rehabilitation der nach Kriegsende 'Amtsverdrängten', wie sie sich in ihrer umfangreichen politischen Lobbyarbeit selbst nannten. Auch die bekannte 'Metamorphose' zwar innovativer, aber politisch korrumpierter Forschungsansätze der dreißiger Jahre wie die der 'volksgeschichtlichen Geopolitik' zur apolitischen 'Landschaftsgeschichte' nach 1945 zeichnet der Autor am Beispiel Crämers nach. Dieses Werk nötigt wegen der Breite und Vielfalt seines Untersuchungsansatzes Respekt ab. Mit ihm gab der Autor zudem wichtige Anstöße für eine inzwischen eingeleitete intensivere Beschäftigung der Ludwig-Maximilians-Universität mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit." Bernd Jürgen Wendt, in: DIE ZEIT, 28.09.2006 "Höhen und Tiefen einer Wissenschaftlerkarriere [...] Jedlitschka ist eine ausgewogene, hoch informative und lesenswerte Monografie gelungen, die am Aufstieg und Fall eines Historikers das heikle Verhältnis von Wissenschaft und Politik im Dritten Reich und den ambivalenten Umgang damit in der Bundesrepublik thematisiert. Hervorzuheben ist der Detailreichtum, mit dem die Untersuchung aufwartet. Individuelle Entscheidungsfindungen werden ebenso gründlich recherchiert wie personelle Netzwerke in Hochschule und Politik. Dieses Buch ist nachdrücklich zur Lektüre empfohlen und sollte weitere, ähnlich gelagerte Untersuchungen anregen." Thomas Keiderling, in: IASLonline (13.09.2006) "[...] Die gleichwohl wissenschaftsgeschichtlich überragenden Verdienste der Arbeit liegen darin, dass der Autor erstmals exemplarisch das lange in diesen Dimensionen nicht bekannte bzw. bewusst verschwiegene Netzwerk zwischen Wissenschaft und Politik im Dritten Reich herausgearbeitet, schonungslos sichtbar und dabei bestens verständlich, ja spannend lesbar gemacht hat - eine teils beklemmende, überaus empfehlenswerte Pflichtlektüre, die den Rezensenten sehr nachdenklich gestimmt hat. In diesen Verstrickungen spielt auch das deutsche Verlagsbuchwesen eine Rolle - für Crämer und andere bot beispielsweise Brockhaus nach 1945 mangels Alternativen eine Art Zuflucht und natürlich die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Besonders anzuerkennen ist auch, dass der Autor in einem eigenen Anhang von 15 Seiten Kurzbiographien bedeutender Persönlichkeiten vorstellt, die in der Universitäts-, Wissenschafts- und Lokalgeschichte des 20. Jahrhunderts eine wichtige, teils herausragende Rolle gespielt haben und von denen einige überhaupt erstmals biographisch erfasst werden. [...]" Franz-Rasso Böck, in: Allgäuer Geschichtsfreund, Nummer 106 (2006)
Cuprins
Einleitung 1. Jugend und Studienjahre. Sozialisation im Zeichen bündisch-völkischer Prägung (1907-1929) 2. Nationalsozialismus als Chance. Karriere durch die Nähe zur Macht (1930-1936) Weimar. Im Dienste zweier Herren: »Carl-August-Werk« und Einsatz für die »nationale Revolution« (1930-1933) - Berlin. Politikberater der braunen Macht: Referent für die »Reichsreform« (1934/1935) - Jena. Akademische Karriere an der Thüringischen »Trutz-Universität« (1934-1936) - Erste Spannungen im »Carl-August-Werk« - Dienst mit der Feder. Crämers »Politische Schriftstellerei« - Weimar, Berlin, Jena. Stationen des SS-Intellektuellen 3. München. Höhepunkt der akademischen Karriere in der »Hauptstadt der Bewegung« (1936-1945) Die Vorgeschichte. Der »Fall Oncken« und die Folgen: Ein Lehrstück nationalsozialistischer Hochschulpolitik - Machtprobe in München. Der Kampf um die Berufung - Die Vertretungszeit an der Münchner Universität - Professor von Hitlers Gnaden. Die Berufung auf das Münchner Ordinariat 4. Crämers Schrifttum. Historia magistra vitae - Politikberatung als »Rückwärtsgewandter Prophet« Die Reichsstadt Straßburg und verwandte Themen - Synthese Weimar, Potsdam. Arbeiten zum Zeitalter des Absolutismus - Konzept einer volksgeschichtlichen Geopolitik - Der Historiker als Politikberater. Grundlinien der Crämerschen Geschichtsinterpretation 5. Ende des »Dritten Reiches« - Ende einer Karriere (1945-1950) Internierung und Entnazifizierung - Self-made-man in der Wiederaufbaugesellschaft. Der steinige Weg vom Töpfer zum Verlagslektor 6. Exkurs. Neue Hoffnung - Der »Verband der nicht-amtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer« Gründung und Profil im Kontext der Neuorganisation von Beamten- und Hochschulverbänden - Bayern und der Kampf der »Amtsverdrängten«. Der Bayerische Landesverband des VNAH - Resümee und Ausblick 7. Comeback? (1951-1959) Ein unerwünschter Bewerber. Rückkehrversuche nach München - Werke aus der Nachkriegszeit 8. Gerichtlicher Kampf mit Universität und Ministerium (1960-1965) 9. Die Causa Crämer. »Akademische Vergangenheitspolitik« in Bayern Wille zur Aufarbeitung? Das Verhalten von Universität, Ministerien und Gerichten - Helfer in der Not? Personen und Motive - Resümee: »Akademische Vergangenheitspolitik« und ihre Grenzen 10. Brockhaus und Homer. Refugium und Weltabkehr (1966-1992) Schlussbetrachtung Anhang Kurzbiographien Quellen- und Literaturverzeichnis Personenregister